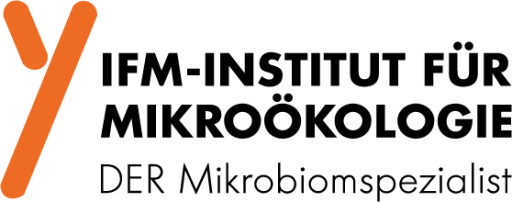alphaspirit/AdobeStock
alphaspirit/AdobeStock
Bedrohte Schutz- und Immunflora
02. Oktober 2018Genau wie andere Ökosysteme ist auch die Mikrobengemeinschaft in unserem Darm bedroht. Das hat Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Darmflora, auf deren Unterstützung wir angewiesen sind.

Frühere Generationen waren gut mit Bakterien versorgt: Während der natürlichen Geburt, beim Leben auf dem Bauernhof und beim Spielen mit vielen anderen Kindern fanden die verschiedensten Bakterien den Weg in den Darm und trugen dort zu einer bunten Lebensgemeinschaft bei. Nachschub war jederzeit und auch im späteren Leben noch garantiert.

Im Vergleich dazu wachsen wir heute keimarm auf und auch als Erwachsene nehmen wir uns vor Bakterien in Acht. Zusätzlich verringern zum Beispiel Antibiotikatherapien, Stress und eine einseitige Ernährung die ohnehin schon eingeschränkte Bakterienvielfalt im Darm. Das Ergebnis kann ein aus dem Gleichgewicht geratenes Ökosystem sein, das seine Aufgaben nicht mehr erfüllt.
Wichtige Aufgaben der Darmflora sind die Abwehr von Krankheitserregern und das Training unseres Immunsystems.
Schutzflora: Kein Platz für Krankheitserreger
Eine intakte Darmflora bildet einen dichten Bakterienrasen auf der Schleimhaut. Ähnlich wie fremdes Saatgut auf einem dicht bewachsenen Rasen kaum die Chance bekommt zu keimen, verhält es sich bei der intakten Darmflora: Nehmen wir schädliche Bakterien, Viren oder Pilze mit der Nahrung, der Luft oder aus der Umgebung auf, finden sie nicht den nötigen Platz, um sich anzusiedeln und zu vermehren.
Und hat doch ein Erreger eine kleine Lücke gefunden, unterdrücken die Bakterien der Schutzflora sein Wachstum über antibiotische Stoffe und saure Stoffwechselprodukte. Deshalb scheiden wir fremde Erreger bei einer intakten Darmflora meist ohne Beschwerden wieder aus.
Ist die Darmflora geschädigt, sieht das anders aus: Wie Saatgut auf offener Erde treffen fremde Erreger auf freie Flächen und ein gutes Nährstoffangebot. Sie können sich explosionsartig vermehren und starke Beschwerden verursachen. Das geschieht zum Beispiel, wenn eine Behandlung mit Antibiotika Löcher in den Bakterienrasen gerissen hat und sich der Durchfallerreger Clostridium difficile rasend schnell ausbreitet.
Es muss aber nicht immer so drastisch ablaufen. Bei vielen kleinen Schäden an der Darmflora können sich nach und nach unerwünschte Erreger ansiedeln, bis sich die Zusammensetzung der Darmflora stark verschoben hat und Beschwerden auftreten.
Immunflora: Lebenslanges Training
Die Bakterien der Immunflora trainieren unser Abwehrsystem: Sie machen die Immunzellen fit für eine effektive Abwehr, wenn wir mit Krankheitserregern in Berührung kommen. Außerdem lernt das Immunsystem mit Hilfe der Bakterien, bei ungefährlichen Stoffen wie zum Beispiel Allergenen auf eine unnötige Immunreaktion zu verzichten. Ohne das ständige Training der Immunflora wäre unser Immunsystem nicht so leistungsfähig, wie wir es kennen und brauchen.
Im Darm befindet sich die Immunzentrale des Körpers - mit etwa 85 Prozent aller Immunzellen. Dort treten die Immunzellen mit der Darmflora in Kontakt, dabei sammeln und speichern sie Informationen. Anschließend schickt das Immunsystem die Abwehrzellen auf die Reise durch den Körper. Die aktivierten Immunzellen verteilen sich auf die Atemwege, die Speicheldrüsen, die Harnwege, die Haut und die Brustdrüsen stillender Mütter. Ein Teil der Abwehrzellen kehrt wieder in den Darm zurück, um das Immunsystem an der Darmschleimhaut weiter zu unterstützen.
Damit hat das Immuntraining im Darm Auswirkungen auf den gesamten Körper.
Kyber-Diagnostik: So einfach geht's!

In welchem Zustand sich das mikrobielle Ökosystem im Darm befindet, lässt sich mit Hilfe der Kyber®-Diagnostik erkennen.
Für die Diagnostik erhalten Sie von Ihrem Arzt oder Therapeut ein Stuhlentnahme-Set mit ausführlicher Anleitung, das Sie mit nach Hause nehmen können. Das Set mit dem befüllten Stuhlröhrchen senden Sie per Post an das MVZ Institut für Mikroökologie GmbH.
Nach etwa einer Woche erhält Ihr Arzt oder Therapeut einen Befund mit darauf abgestimmten Ernährungs- und Therapieempfehlungen. Selbstverständlich liegt die Auswahl der für Sie geeigneten Behandlungsmaßnahmen im Ermessen Ihres Arztes oder Therapeuten, der Sie und Ihre Beschwerden am besten kennt.