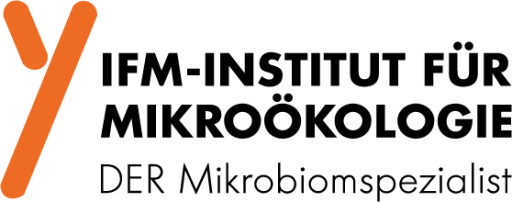Mikhaylovskiy/AdobeStock
Mikhaylovskiy/AdobeStock
Wenn’s juckt und riecht: Hilfe bei Vaginalbeschwerden
15. September 2022 Viele Frauen kennen das und für manche wird es zur anhaltenden Belastung: Die Scheide juckt und brennt, der Ausfluss riecht unangenehm. Schuld an den Beschwerden ist eine ungünstige Mischung der Bakterien im Vaginalbereich. Im natürlichen Gleichgewicht helfen uns die Bakterien in und auf unserem Körper, gesund zu bleiben. Egal ob im Darm, auf der Haut oder im Vaginalbereich: Die natürliche Flora wehrt Krankheitserreger ab, indem sie die Oberflächen dicht besetzt und den Krankheitserregern nicht den Platz lässt, um sich anzusiedeln und zu vermehren. Manche Bakterien der natürlichen Flora bilden zusätzlich Stoffe, die die Krankheitserreger direkt am Wachstum hindern oder sogar abtöten.
Viele Frauen kennen das und für manche wird es zur anhaltenden Belastung: Die Scheide juckt und brennt, der Ausfluss riecht unangenehm. Schuld an den Beschwerden ist eine ungünstige Mischung der Bakterien im Vaginalbereich. Im natürlichen Gleichgewicht helfen uns die Bakterien in und auf unserem Körper, gesund zu bleiben. Egal ob im Darm, auf der Haut oder im Vaginalbereich: Die natürliche Flora wehrt Krankheitserreger ab, indem sie die Oberflächen dicht besetzt und den Krankheitserregern nicht den Platz lässt, um sich anzusiedeln und zu vermehren. Manche Bakterien der natürlichen Flora bilden zusätzlich Stoffe, die die Krankheitserreger direkt am Wachstum hindern oder sogar abtöten.
Starke Abwehr: Schutzflora der Scheide
Bei vaginalen Problemen keinen Joghurt in die Scheide einführen!
In einem gesunden Scheidenmilieu befinden sich vor allem Milchsäurebakterien, Frauenärzte sprechen auch von Laktobazillen oder Döderlein-Bakterien. Milchsäurebakterien sind bekannt als Bestandteil von Joghurt und probiotischen Produkten. Allerdings gibt es unterschiedliche Laktobazillenarten: Zur Herstellung von Joghurt eignen sich andere Arten als zum Schutz des Vaginalbereichs. Daher bei vaginalen Problemen bitte keinen Joghurt in die Scheide einführen!
 Eins haben aber alle Milchsäurebakterien gemeinsam: Wie ihr Name schon sagt, bilden sie Milchsäure. Die starke Säure senkt den pH-Wert in der Scheide und macht damit unerwünschten Erregern das Leben schwer. In einer gesunden Vagina liegt der pH-Wert zwischen 3,8 und 4,4. Manche Milchsäurebakterien produzieren zusätzlich Wasserstoffperoxid. Der vielen vom Haarebleichen bekannte Stoff stellt im Vaginalbereich ein natürliches Abwehrsystem dar. Gegen das Wasserstoffperoxid haben auch die Erreger keine Chance, denen die Milchsäure nichts anhaben kann. Ein Beispiel dafür sind die Hefepilze.
Eins haben aber alle Milchsäurebakterien gemeinsam: Wie ihr Name schon sagt, bilden sie Milchsäure. Die starke Säure senkt den pH-Wert in der Scheide und macht damit unerwünschten Erregern das Leben schwer. In einer gesunden Vagina liegt der pH-Wert zwischen 3,8 und 4,4. Manche Milchsäurebakterien produzieren zusätzlich Wasserstoffperoxid. Der vielen vom Haarebleichen bekannte Stoff stellt im Vaginalbereich ein natürliches Abwehrsystem dar. Gegen das Wasserstoffperoxid haben auch die Erreger keine Chance, denen die Milchsäure nichts anhaben kann. Ein Beispiel dafür sind die Hefepilze.
Schutzflora unter Beschuss
 Gerät die Scheidenflora aus ihrer natürlichen Balance, kann sie eindringende Erreger nicht mehr effektiv abwehren. Ein gestörtes Gleichgewicht kann verschiedene Ursachen haben. In den meisten Fällen sind eine übertriebene, selten auch mangelnde Intimhygiene und ungeschützter Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partnern Auslöser. Oft sind auch Antibiotika für ein Ungleichgewicht verantwortlich. Mit der Einnahme von Antibiotika werden nicht nur die Krankheitserreger bekämpft, sondern auch die natürliche Schutzflora. Hormonelle Schwankungen, wie sie während der Menstruation, einer Schwangerschaft oder der Wechseljahre auftreten, können die natürliche Scheidenflora verändern und sie anfälliger für eine Fehlbesiedlung und Infektionen machen. Auch Sperma lässt den pH-Wert ansteigen und macht die Scheide für etwa sechs bis acht Stunden störanfälliger als normal. Für empfindliche Frauen empfiehlt sich deshalb die Verwendung von Kondomen. Letztlich ist auch die Pille nicht selten Ursache für die Entstehung des bakteriellen Ungleichgewichts.
Gerät die Scheidenflora aus ihrer natürlichen Balance, kann sie eindringende Erreger nicht mehr effektiv abwehren. Ein gestörtes Gleichgewicht kann verschiedene Ursachen haben. In den meisten Fällen sind eine übertriebene, selten auch mangelnde Intimhygiene und ungeschützter Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partnern Auslöser. Oft sind auch Antibiotika für ein Ungleichgewicht verantwortlich. Mit der Einnahme von Antibiotika werden nicht nur die Krankheitserreger bekämpft, sondern auch die natürliche Schutzflora. Hormonelle Schwankungen, wie sie während der Menstruation, einer Schwangerschaft oder der Wechseljahre auftreten, können die natürliche Scheidenflora verändern und sie anfälliger für eine Fehlbesiedlung und Infektionen machen. Auch Sperma lässt den pH-Wert ansteigen und macht die Scheide für etwa sechs bis acht Stunden störanfälliger als normal. Für empfindliche Frauen empfiehlt sich deshalb die Verwendung von Kondomen. Letztlich ist auch die Pille nicht selten Ursache für die Entstehung des bakteriellen Ungleichgewichts.
Schwangerschaft und vaginales Ungleichgewicht
 Während einer Schwangerschaft erhöht ein vaginales Ungleichgewicht das Risiko für vorzeitige Wehentätigkeit, Blasensprung und Frühgeburt. In der Schwangerschaft wird deshalb oft routinemäßig der pH-Wert in der Scheide gemessen, um einen ersten Hinweis auf eine Fehlbesiedlung zu erhalten. Allerdings erlaubt der pH-Wert keine gesicherte Aussage, denn auch bei normalem pH-Wert können Fehlbesiedlungen auftreten. Vaginalduschen können das natürliche Gleichgewicht ebenfalls stören. Die Anwendung schwemmt Teile der schützenden Scheidenflora aus, verändert den pH-Wert ungünstig und ebnet damit Infektionen den Weg.
Während einer Schwangerschaft erhöht ein vaginales Ungleichgewicht das Risiko für vorzeitige Wehentätigkeit, Blasensprung und Frühgeburt. In der Schwangerschaft wird deshalb oft routinemäßig der pH-Wert in der Scheide gemessen, um einen ersten Hinweis auf eine Fehlbesiedlung zu erhalten. Allerdings erlaubt der pH-Wert keine gesicherte Aussage, denn auch bei normalem pH-Wert können Fehlbesiedlungen auftreten. Vaginalduschen können das natürliche Gleichgewicht ebenfalls stören. Die Anwendung schwemmt Teile der schützenden Scheidenflora aus, verändert den pH-Wert ungünstig und ebnet damit Infektionen den Weg.
Welche Symptome deuten auf ein Ungleichgewicht in der Vagina hin?
Haben sich unerwünschte Erreger vermehrt, kann es zu typischen Beschwerden kommen wie:
- Juckreiz
- Brennen
- Trockenheit
- Vermehrter Ausfluss
- Fischiger Geruch
- Irritationen oder Schmerzen während und nach dem Geschlechtsverkehr
Wann eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen?
Halten die oben beschriebenen Beschwerden über einen längeren Zeitraum an, sollte eine Ärztin oder ein Arzt aufgesucht werden. Die Symptome können auf ein Ungleichgewicht der Scheidenflora und damit verbundene Erkrankungen hindeuten.
Vaginose, Candidose oder Vaginitis: Was juckt hier genau?
 Fachleute haben verschiedene Begriffe für das Ungleichgewicht in der Vaginalflora, je nachdem welche Erreger sich in der Scheide ausgebreitet haben. Bei einer bakteriellen Vaginose haben sich vor allem Bakterien der Arten Gardnerella vaginalis und Fannyhessea (Atopobium) vaginae stark vermehrt. Selbst Antibiotika haben bei einer bakteriellen Vaginose kein leichtes Spiel. Die Bakterien setzen sich an der Scheidenwand fest und bilden eine gelartige Schicht um sich herum. Dieser Biofilm schützt sie vor den Abwehrreaktionen des Immunsystems und vor Antibiotika.
Fachleute haben verschiedene Begriffe für das Ungleichgewicht in der Vaginalflora, je nachdem welche Erreger sich in der Scheide ausgebreitet haben. Bei einer bakteriellen Vaginose haben sich vor allem Bakterien der Arten Gardnerella vaginalis und Fannyhessea (Atopobium) vaginae stark vermehrt. Selbst Antibiotika haben bei einer bakteriellen Vaginose kein leichtes Spiel. Die Bakterien setzen sich an der Scheidenwand fest und bilden eine gelartige Schicht um sich herum. Dieser Biofilm schützt sie vor den Abwehrreaktionen des Immunsystems und vor Antibiotika.
Fannyhessea (Atopobium) vaginae ist gegen das oft verwendete Antibiotikum Metronidazol resistent. Nach der Therapie kann sich das Bakterium noch besser ausbreiten, weil die Schutzflora durch die Antibiotika in Mitleidenschaft gezogen ist. Deshalb kommt es nach einer Behandlung häufig zu Rückfällen.
Auch hohe Zellzahlen des Milchsäurebakteriums Lactobacillus iners deuten auf eine instabile Vaginalflora hin. Es bildet kein Wasserstoffperoxid und auch andere Schutzmechanismen fehlen ihm. Tritt Lactobacillus iners vermehrt auf, begünstigt es die Rückfallneigung der Patientinnen. Das Bakterium schützt aber nicht nur weniger, es kann auch direkt Schaden anrichten: Lactobacillus iners scheidet die gleichen Giftstoffe aus wie Gardnerella vaginalis und begünstigt Entzündungen.
Vaginale Entzündungen können auch durch Mobiluncus und Prevotella Bakterien gefördert werden. Diese Bakterien produzieren Substanzen, die den pH-Wert der Vagina erhöhen und das Wachstum schädlicher Bakterien begünstigen.
Bei einer Candidose hat sich in den meisten Fällen der Hefepilz Candida albicans in der Scheide ausgebreitet. Seltener sind es andere Vertreter aus der Familie der Hefepilze.
Wie kann Frau vorbeugen?
Damit das Scheidenmilieu gar nicht erst aus dem Gleichgewicht gerät, solltest du keine übertriebene Vaginalhygiene betreiben. Die Reinigung mit Wasser ist ausreichend. Bei der Unterwäsche gibt es auch einiges zu beachten: Vermeide das Tragen synthetischer Unterwäsche über längere Zeiträume. Unterhosen aus Baumwolle sind empfehlenswert. Und natürlich: Täglich Unterwäsche wechseln! Besonders wenn du häufig wechselnde Geschlechtspartner hast, solltest du auf geschützten Verkehr mit einem Kondom achten. Wenn du häufig an Problemen im Vaginalbereich leidest, denk auch an die Behandlung deines Partners.
Sanft zurück ins Gleichgewicht
 Ist die Behandlung nicht genau auf die Art der Fehlbesiedlung abgestimmt, kann die Schutzflora noch weiter aus der Balance geraten und die Beschwerden können chronisch werden. Eine Vaginalflora-Diagnostik wie der VagiBiom vom Institut für Mikroökologie weist die unterschiedlichen Erreger nach: Bakterien, die unsere Vaginalflora schützen, und Bakterien, die Beschwerden auslösen können. Daraus leitet sich eine Therapie ab, die die unerwünschten Erreger so floraschonend wie möglich beseitigt und die natürliche Besiedlung der Scheide wieder ins Gleichgewicht bringt. Auch einem Rückfall der Erkrankung kann so entgegengewirkt werden.
Ist die Behandlung nicht genau auf die Art der Fehlbesiedlung abgestimmt, kann die Schutzflora noch weiter aus der Balance geraten und die Beschwerden können chronisch werden. Eine Vaginalflora-Diagnostik wie der VagiBiom vom Institut für Mikroökologie weist die unterschiedlichen Erreger nach: Bakterien, die unsere Vaginalflora schützen, und Bakterien, die Beschwerden auslösen können. Daraus leitet sich eine Therapie ab, die die unerwünschten Erreger so floraschonend wie möglich beseitigt und die natürliche Besiedlung der Scheide wieder ins Gleichgewicht bringt. Auch einem Rückfall der Erkrankung kann so entgegengewirkt werden.
Ätherische Öle für ein natürliches Scheidenmilieu
Ätherische Öle sind eine sanfte Alternative zu Antibiotikum, um die Krankheitserreger in ihrem Wachstum zu stoppen. Sie eignen sich dank ihrer antibakteriellen Wirkung zur Behandlung von Vaginalinfektionen, Harnwegsinfektionen, hartnäckigen Erkältungen, Bronchialerkrankungen, Hauterkrankungen wie z.B. Akne oder auch bei Entzündungen des Zahnbetts. Die Ärztin oder der Arzt verschreibt dazu eine Rezeptur, die in der Apotheke in Form von Kapseln, Lösungen, Vaginalzäpfchen oder Salben verarbeitet wird. Positiver Nebeneffekt: Der Duft! Die ätherischen Öle riechen angenehm nach Zitronengras oder Rosmarin. Mehr zu ätherischen Ölen erfährst du in unserem Blogbeitrag „Wirken ätherische Öle antibakteriell?“

Dr. Thomas Ellwanger erklärt:
VagiBiom: So funktioniert‘s!
Für die VagiBiom-Diagnostik erhältst du von deiner Ärztin oder deinem Arzt ein Probeentnahme-Set mit einem Abstrichtupfer und ausführlicher Anleitung, das du mit nach Hause nehmen können. Nach der Probenentnahme sendest du das Set mit dem Vaginalabstrich kostenfrei an die aufgedruckte Adresse. Nach etwa einer Woche erhält dein Arzt oder deine Ärztin einen Befund mit passenden Therapieempfehlungen. Selbstverständlich liegt die Auswahl der für dich geeigneten Behandlungsmaßnahmen im Ermessen deiner Ärztin oder deines Arztes, die oder der dich und deine Beschwerden am besten kennt. In der Regel dauert es einen Monatszyklus, bis die Scheidenflora wiederaufgebaut ist. Es sei denn, der Biofilm ist noch vorhanden und konnte durch die Therapie nicht komplett aufgelöst werden. Dann sollte die Behandlung fortgesetzt werden.