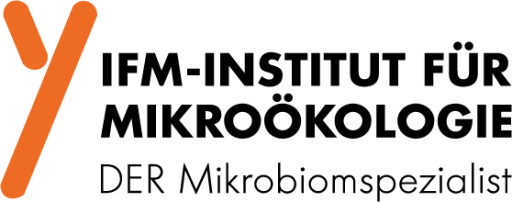Für Ärzte und Therapeuten
Herborner Mikrobiom Tage
Herborner Mikrobiom Tage 2025
Das weibliche Mikrobiom in der Praxis – Frauengesundheit auf dem nächsten Level
Von Freitag, den 13.06.2025 bis Sonntag, den 15.06.2025 fanden zum dritten Mal unsere Herborner Mikrobiom Tage statt. Dieses Jahr stand der Darm und unsere mentale Gesundheit im Mittelpunkt. Im folgenden finden Sie die Zusammenfassungen der Vorträge. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und freuen uns, Sie auf den Herborner Mikrobiom Tagen 2025 willkommen zu heißen!
Herzliche Grüße
Ihr Team des MVZ Institut für Mikroökologie
Rückblick
Geschäftsführer Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schwiertz begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Freitagabend im Institut für Mikroökologie und stellte das Expertenteam des MVZ Institut für Mikroökologie vor. In diesem Jahr stand die Frauengesundheit im Fokus. Aus verschiedenen Blickwinkeln – psychologisch, medizinisch und naturwissenschaftlich – sollte das Thema näher beleuchtet werden.


Die Ernährungswissenschaftlerin Dr. rer. nat. Dorothea Portius eröffnete die Herborner Mikrobiom Tage am Freitagabend mit einem Impulsvortrag zum Thema "Im Takt des Lebens: Zyklusbewusste Ernährung und ein integrativer Ansatz für die Frauengesundheit". Dr. rer. nat. Dorothea Portius vereint umfassende Expertise in Ernährungswissenschaft und Forschung mit praktischer Erfahrung im Gesundheitssektor. Ihre akademische Laufbahn begann mit einer Promotion an der Universität Genf, gefolgt von vertiefenden Forschungsprojekten in San Diego, USA. Derzeit ist sie als Habilitandin und Forscherin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg tätig sowie an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn. Ebenso berät sie als Medical & Scientific Advisor diverse Firmen und Start-Ups in der Gesundheitsbranche. Durch ihre Arbeit in verschiedenen Fachgremien, wie dem Beirat der Deutschen Adipositas-Gesellschaft (DAG) und der Deutschen Gesellschaft für Ernährungspsychologie (DGEP), leistet sie wichtige Beiträge zu zentralen Diskursen im Gesundheitswesen. Ihr Engagement für die Wissensvermittlung zeigt sich nicht nur in fachlichen Publikationen und Büchern, sondern auch in ihrer Rolle als Ernährungsexpertin für den MDR und das ARD.
Der Vortrag „Im Takt des Lebens“ widmete sich dem Einfluss einer zyklusbewussten Ernährung auf die weibliche Gesundheit und betonte die Notwendigkeit eines integrativen, lebensphasenübergreifenden Ansatzes. Im Mittelpunkt stand dabei die Erkenntnis, dass der weibliche Stoffwechsel – anders als der des Mannes – hochgradig flexibel ist und stark durch hormonelle Schwankungen beeinflusst wird. Während der männliche Stoffwechsel eher konstant und linear verläuft, ähnelt der weibliche einem fein abgestimmten Orchester, das leicht aus dem Takt geraten kann – mit potenziell weitreichenden Folgen für das hormonelle Gleichgewicht.
Diese Unterschiede spiegeln sich nicht nur in der Körperzusammensetzung und dem Energiehaushalt wider, sondern auch in der Mikronährstoffversorgung und im Krankheitsrisiko. So sind beispielsweise der Fettanteil, die Glykogenspeicher, die hormonelle Regulation und die Sensitivität auf Hunger- und Sättigungshormone wie Leptin und Ghrelin bei Frauen und Männern unterschiedlich ausgeprägt. Besonders deutlich werden diese Unterschiede im Verlauf des Menstruationszyklus, in dem sich auch der Nährstoffbedarf kontinuierlich verändert.
In der Menstruationsphase treten entzündliche Prozesse auf, die durch Omega-3-Fettsäuren und antientzündliche Mikronährstoffe günstig beeinflusst werden können. In der Follikelphase – in der sich der weibliche Stoffwechsel dem männlichen annähert – steigt der Energielevel, weshalb hier eisen- und vitaminreiche Ernährung besonders unterstützend wirkt. Die Ovulation geht mit Gewebeveränderungen einher, die eine antioxidative Ernährung mit Zink erfordern. In der Lutealphase hingegen sinkt die Insulinsensitivität, was häufig mit Heißhunger, Stimmungsschwankungen und einem erhöhten Bedarf an Magnesium und Vitamin B6 einhergeht.
Ein weiteres zentrales Thema war die Menopause, die durch den demografischen Wandel und das zunehmende Durchschnittsalter der Bevölkerung immer mehr an gesellschaftlicher Relevanz gewinnt. Frauen verbringen mittlerweile rund ein Drittel ihres Lebens in dieser Phase, die mit spezifischen gesundheitlichen Herausforderungen einhergeht. Es wird geschätzt, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen zyklus- und hormonell bedingter Beschwerden weltweit bis zu eine Billion US-Dollar betragen.
Vor diesem Hintergrund plädierte Frau Dr. Portius für einen Paradigmenwechsel: Weg von geschlechtsneutralen Durchschnittsdaten, hin zu einem personalisierten, weiblich orientierten Gesundheitsverständnis. Dabei könnten moderne Technologien wie Wearables, Ernährungs-Apps und Sensordaten eine zentrale Rolle spielen – etwa durch die Verknüpfung von Zyklusdaten mit Bewegungs- und Ernährungsverhalten. Nur durch einen individualisierten und phasenorientierten Zugang könne die Resilienz von Frauen gestärkt, Beschwerden reduziert und die Selbstregulation des Körpers nachhaltig unterstützt werden.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://dorotheaportius.de





In geselliger Runde mit abwechslungsreichen Fingerfood bestand Zeit zum Austauschen und Netzwerken. Bei einer anschließenden Laborführung konnte der Weg einer Probe durch das IfM-Labor vom Probeneingang bis zum Befund nachvollzogen werden.
Am Samstagmorgen begrüßte Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schwiertz alle Teilnehmenden mit einer kurzen Einführung in das Thema und das diesjährige Programm. Er stellte zudem die Aussteller der kleinen Industriemesse vor. Hier hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit sich über probiotische Produkte und die Mikrobiomdiagnostik zu informieren. Kemja Metz und Malte Burkert vom IfM-Außendienst betreute den IfM-Stand vor Ort.
Der Vortrag „Im Takt des Lebens“ widmete sich dem Einfluss einer zyklusbewussten Ernährung auf die weibliche Gesundheit und betonte die Notwendigkeit eines integrativen, lebensphasenübergreifenden Ansatzes. Im Mittelpunkt stand dabei die Erkenntnis, dass der weibliche Stoffwechsel – anders als der des Mannes – hochgradig flexibel ist und stark durch hormonelle Schwankungen beeinflusst wird. Während der männliche Stoffwechsel eher konstant und linear verläuft, ähnelt der weibliche einem fein abgestimmten Orchester, das leicht aus dem Takt geraten kann – mit potenziell weitreichenden Folgen für das hormonelle Gleichgewicht.
Diese Unterschiede spiegeln sich nicht nur in der Körperzusammensetzung und dem Energiehaushalt wider, sondern auch in der Mikronährstoffversorgung und im Krankheitsrisiko. So sind beispielsweise der Fettanteil, die Glykogenspeicher, die hormonelle Regulation und die Sensitivität auf Hunger- und Sättigungshormone wie Leptin und Ghrelin bei Frauen und Männern unterschiedlich ausgeprägt. Besonders deutlich werden diese Unterschiede im Verlauf des Menstruationszyklus, in dem sich auch der Nährstoffbedarf kontinuierlich verändert.
In der Menstruationsphase treten entzündliche Prozesse auf, die durch Omega-3-Fettsäuren und antientzündliche Mikronährstoffe günstig beeinflusst werden können. In der Follikelphase – in der sich der weibliche Stoffwechsel dem männlichen annähert – steigt der Energielevel, weshalb hier eisen- und vitaminreiche Ernährung besonders unterstützend wirkt. Die Ovulation geht mit Gewebeveränderungen einher, die eine antioxidative Ernährung mit Zink erfordern. In der Lutealphase hingegen sinkt die Insulinsensitivität, was häufig mit Heißhunger, Stimmungsschwankungen und einem erhöhten Bedarf an Magnesium und Vitamin B6 einhergeht.
Ein weiteres zentrales Thema war die Menopause, die durch den demografischen Wandel und das zunehmende Durchschnittsalter der Bevölkerung immer mehr an gesellschaftlicher Relevanz gewinnt. Frauen verbringen mittlerweile rund ein Drittel ihres Lebens in dieser Phase, die mit spezifischen gesundheitlichen Herausforderungen einhergeht. Es wird geschätzt, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen zyklus- und hormonell bedingter Beschwerden weltweit bis zu eine Billion US-Dollar betragen.
Vor diesem Hintergrund plädierte Frau Dr. Portius für einen Paradigmenwechsel: Weg von geschlechtsneutralen Durchschnittsdaten, hin zu einem personalisierten, weiblich orientierten Gesundheitsverständnis. Dabei könnten moderne Technologien wie Wearables, Ernährungs-Apps und Sensordaten eine zentrale Rolle spielen – etwa durch die Verknüpfung von Zyklusdaten mit Bewegungs- und Ernährungsverhalten. Nur durch einen individualisierten und phasenorientierten Zugang könne die Resilienz von Frauen gestärkt, Beschwerden reduziert und die Selbstregulation des Körpers nachhaltig unterstützt werden.


Am Samstag Vormittag startete Priv.-Doz. Dr. med. Dr. phil. Patrick Finzer mit seinem Vortrag zum Thema "Das genitale Mikrobiom – Klinische Relevanz bei Infektionen, Entzündung und Kinderwunsch". Er ist Facharzt für Mikrobiologie, Infektionsepidemiologie und Laboratoriumsmedizin an der dus.ana in Düsseldorf. Nach dem Studium der Medizin und Philosophie arbeitet Patrick Finzer am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in der Abteilung Angewandte Tumorvirologie (ATV) und habilitiert an der Universität Heidelberg. Nach seiner Tätigkeit bei nationalen und internationalen medizinischen Laboren gründet er 2019 sein eigenes Diagnostiklabor „dus.ana“ in Düsseldorf. Darüber hinaus leitet er eine Arbeitsgruppe an der Universität Düsseldorf mit dem Fokus auf medizinische Aspekte des humanen oralen und genitalen Mikrobioms.
Dr. Patrick Finzer widmete sich in seinem Vortrag dem genitalen Mikrobiom der Frau und dessen zentraler Rolle für Gesundheit, Infektanfälligkeit und Fertilität. Trotz seiner großen klinischen Relevanz, insbesondere im Vergleich zu besser erforschten Mikrobiomen wie dem des Darms, wird das vaginale Mikrobiom bisher wenig beachtet – obwohl es sich im Gegensatz zu anderen Körperregionen durch eine auffällig geringe Biodiversität auszeichnet. Gesunde Vaginalmilieus sind typischerweise von Laktobazillen dominiert, wobei einzelne Spezies wie L. crispatus, L. jensenii oder L. gasseri als besonders stabil gelten. Das Vorkommen von Lactobacillus iners hingegen weist oft auf ein instabiles oder „shiftendes“ Mikrobiom hin und steht mit Infektionen oder Fertilitätsstörungen in Zusammenhang.
Ein zentrales Thema war die bakterielle Vaginose als Form der Dysbiose: Sie fördert genitale Infektionen wie Chlamydien oder HPV und kann die Entstehung einer Schwangerschaft erheblich beeinträchtigen. Auch das endometriale Mikrobiom – also jenes in Gebärmutter und Eileitern – spielt hierbei eine wichtige Rolle. Studien zeigen, dass sich dieses vom vaginalen Mikrobiom unterscheidet und ebenfalls entscheidend für die erfolgreiche Einnistung sein kann. Der Nachweis erfolgt bislang über vaginale Probenentnahme, was diagnostisch gewisse Unsicherheiten birgt.
Besonders eindrucksvoll war der Hinweis auf therapeutische Erfolge durch gezielte Mikrobiommodulation: Nach einer Antibiotikatherapie konnte durch den Einsatz von Probiotika oder sogar Mikrobiomtransplantationen – also der Übertragung gesunder Vaginalflora – die Fertilitätsrate deutlich verbessert werden. In einer Studie stieg die Erfolgsrate einer IVF-Behandlung von 9,4 % auf 33,6 %, wenn im Anschluss Probiotika verabreicht wurden.
Dr. Finzer sprach sich für den verstärkten Einsatz moderner Sequenziertechnologien und personalisierter Mikrobiomanalysen aus. Diese könnten künftig helfen, gezielte Therapien zu entwickeln, etwa durch Pro- und Präbiotika oder die gezielte Schonung nützlicher Laktobazillen im Rahmen einer Infektionsbehandlung. Auch mögliche antientzündliche oder sogar antitumorale Wirkungen bestimmter Mikroben-Präparate wurden angesprochen. Abschließend betonte Dr. Finzer die Notwendigkeit, das Mikrobiom immer im Kontext der jeweiligen Lebensphase – sei es Reproduktionszeit, Schwangerschaft oder Menopause – zu betrachten.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://dus-ana.de/fachaerztliches-labor





Dr. med. Elke Heßdörfer, Fachärztin für Urologie Blasenzentrum Westend in Berlin-Charlottenburg, referierte über alternative Therapieoptionen bei interstitielle Zystitis (IC) und das Blasenschmerzsyndrom (Bladder Pain Syndrome/BPS). Sie studierte Medizin an den Universitäten Erlangen-Nürnberg und Rennes (Frankreich). Ihre urologische Facharztausbildung absolvierte sie an der Urologischen Klinik und Poliklinik Erlangen sowie an der Urologischen Klinik und Poliklinik Rudolf-Virchow / Charité Berlin. Frau Dr. med. Heßdörfer ist Fachärztin für Urologie und seit 1996 als Urologin in Berlin niedergelassen. Ihr Schwerpunkt ist die weibliche Urologie. Seit über 13 Jahren steht die ganzheitliche Therapie im Fokus ihrer Tätigkeit. Dr. med. Elke Heßdörfer ist Autorin des „Chronische Blasenentzündungen – ein ganzheitlicher Ratgeber“ und Mitglied der AWMF-Leitlinien Interstitielle Cystitis (IC/BPS) und Chronischer Unterbauchschmerz der Frau.
In ihrem Vortrag widmete sich Frau Dr. Heßdörfer der interstitiellen Zystitis (IC) und dem Blasenschmerzsyndrom (BPS), zwei eng verwandten Krankheitsbildern, die durch chronischen Blasenschmerz, Harndrang und häufiges Wasserlassen gekennzeichnet sind – bei gleichzeitigem Ausschluss anderer urologischer oder gynäkologischer Ursachen. Eine international einheitliche Definition fehlt bislang, weshalb häufig unspezifisch von IC/BPS gesprochen wird.
Die interstitielle Zystitis wird als chronisch-entzündliche Erkrankung der Harnblase verstanden, die u. a. durch eine gestörte Schutzschicht des Urothels, Infektionen, Autoimmunreaktionen, Allergien oder Toxine ausgelöst werden kann. Zwei Hauptformen werden unterschieden: der Hunner-Typ mit sichtbaren Läsionen der Blasenschleimhaut und der Nicht-Hunner-Typ mit oder ohne mikroskopisch nachweisbare Veränderungen. Frauen sind etwa neunmal häufiger betroffen als Männer.
Die Ätiopathogenese ist multifaktoriell: Neben strukturellen und immunologischen Faktoren spielen auch Beckenbodenstörungen, neuronale Überempfindlichkeiten, Mastzellinfiltration, gestörte Mikrozirkulation, genetische Einflüsse sowie das Mikrobiom von Darm und Harntrakt eine wichtige Rolle. Zudem können bestimmte Nahrungsmittelbestandteile und eine mögliche Histaminintoleranz Symptome verstärken.
Die differenzialdiagnostische Abklärung ist zentral und umfasst eine umfassende Anamnese, körperliche Untersuchung (inkl. Beckenbodenfunktion), Urinanalysen und weiterführende Verfahren wie Zystoskopie, Uroflowmetrie oder Blasenbiopsien.
Therapeutisch setzt Dr. Heßdörfer auf ein integratives, stufenweises Vorgehen. Neben konservativen Maßnahmen wie Ernährungsumstellung, Stressreduktion und Beckenbodentherapie kommen auch medikamentöse sowie komplementärmedizinische Verfahren zum Einsatz – darunter Akupunktur, Phytotherapie, Ozontherapie oder transkranielle Magnetstimulation. Ziel ist eine individuell angepasste Behandlung, die nicht nur die Blasenbeschwerden, sondern auch mögliche systemische Ursachen berücksichtigt.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.blasenzentrum.de/ueber-uns


Nach der Mittagspause gab die Apothekerin Sabine Bäumer einen Workshop zum Thema "Praktische Aspekte aus der Apotheke für die Frauengesundheit". Sie ist Fachapothekerin für Allgemeinpharmazie, Homöopathie und Naturheilverfahren Eisbär-Apotheke Karlsruhe. Sabine Bäumer studierte Pharmazie in Heidelberg. Schon während des Studiums entdeckte sie ihre Leidenschaft für evidenzbasierte Phytotherapie – ein Schwerpunkt, der bis heute ihre Arbeit bestimmt. Nach ihren Weiterbildungen und Abschlüssen, die nach dem Studium folgten, unter anderem als Fachapothekerin für Allgemeinpharmazie, Naturheilverfahren, Prävention sowie als Präventionsmanagerin, lebt Sabine Bäumer ihre Leidenschaft für ganzheitliche Medizin in ihrer Eisbär Apotheke. Den Fokus setzt sie dabei unter anderem auf Frauen- und Darmgesundheit sowie integrativem Arbeiten. Als Expertin für evidenzbasierte Phytotherapie entwickelt sie unter anderem individuelle Rezepturkonzepte und Eigenherstellungen und vermittelt ihr Wissen gleichermaßen an Patienten, Therapeuten und Kollegen. Darüber hinaus ist Sabine Bäumer als Autorin und Expertin in Fernsehsendungen präsent, wo sie einem breiten Publikum Impulse für ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis gibt.
In ihrem Workshop gab Frau Bäumer einen praxisnahen Einblick in den gezielten Einsatz ätherischer Öle zur Unterstützung des vaginalen Mikrobioms und zur Stärkung der Frauengesundheit. Im Zentrum stand die Aromatherapie als wirkungsvolle, natürliche Ergänzung zur klassischen Therapie – insbesondere im Kontext von Infektionen, Dysbiosen und bakterieller Vaginose.
Ätherische Öle wirken nicht nur angenehm duftend, sondern besitzen nachweislich antivirale, antibakterielle, fungizide und entzündungshemmende Eigenschaften. Ihre komplexen Vielstoffgemische – etwa aus Lavendel, Teebaum, Rosengeranie oder Myrrhe – greifen an verschiedenen Stellen der Zellmembran an und erschweren es pathogenen Bakterien, Resistenzen zu entwickeln. Dadurch kann Aromatherapie die Wirksamkeit von Antibiotika unterstützen und in manchen Fällen sogar gezielter wirken.
Ein besonderes Instrument in der Praxis ist das sogenannte Aromatogramm – eine mikrobiologischer Test, mit dem ermittelt werden kann, welche ätherischen Öle gegen bestimmte Keime besonders wirksam sind. Dies erlaubt eine individuell abgestimmte Therapie, beispielsweise bei Streptokokkeninfektionen, Parodontitis oder vaginaler Dysbiose – ohne die gesunde Darmflora zu beeinträchtigen.
Frau Bäumer hob auch die Vielfalt an Darreichungsformen hervor, etwa in Form von Vaginalzäpfchen, die lokal wirken und bei entsprechender Zusammensetzung sogar systemische Effekte entfalten können. Dabei betonte sie die Bedeutung der richtigen Auswahl – insbesondere in sensiblen Lebensphasen wie der Schwangerschaft: Im ersten Trimester sei von Aromazäpfchen grundsätzlich abzuraten, im weiteren Verlauf müsse individuell entschieden werden.
Der Workshop unterstrich, dass ätherische Öle – richtig eingesetzt – einen bedeutsamen Beitrag zur integrativen Frauengesundheit leisten können. Gleichzeitig appellierte Frau Bäumer an die Apothekenpraxis, sowohl naturheilkundliches Wissen als auch mikrobiologische Diagnostik stärker in den Beratungsalltag zu integrieren.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://eisbaerapotheke.de





Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schwiertz, Geschäftsführer des Institut für Mikroökologie, hielt einen Vortrag zum Thema ”Vaginale Mikrobiota und Darmmikrobiota – ein Crosstalk". Herr Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schwiertz studierte Mikrobiologie und Molekularbiologie in Deutschland, Irland und Russland und promovierte im Jahr 2000 am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke (DIfE). Nach seiner Zeit als Laborleiter der Abteilung Nephrologie des Virchow Klinikums der Charité und wissenschaftlicher Mitarbeiter am DIfE ist er seit 2003 Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung am Institut für Mikroökologie in Herborn. Seit 2010 lehrt er an der Justus Liebig-Universität in Gießen, wo er 2012 seine Habilitation für das Fach „Gastrointestinale Mikrobiologie“ erlangte und 2019 zum außerplanmäßigen Professor ernannt wurde.
Dr. Andreas Schwiertz zeigte in seinem Vortrag auf, dass Veränderungen im Scheidenmilieu, die die Gesundheit beeinträchtigen können, sind nicht immer leicht festzustellen und zu behandeln sind. Manche Keime, die unter bestimmten Umständen Infektionen auslösen können, sind im Mikroskop nur schwer erkennbar. Auch der pH-Wert der Scheide kann manchmal ein falsches Bild geben. Zusätzlich machen hartnäckige Bakterienansammlungen – sogenannte Biofilme – eine Behandlung, besonders bei bakterieller Vaginose, oft komplizierter.
Es ist sehr wichtig, Veränderungen im Scheidenmilieu frühzeitig und zuverlässig zu erkennen. Denn wenn Ärztin oder Arzt zusammen mit der Patientin rechtzeitig dafür sorgen, dass sich die gesunden Bakterien wieder ansiedeln, kann die Bildung von hartnäckigen Bakterienfilmen verhindert werden. So lassen sich auch Infektionen im Intimbereich und im Harntrakt wirksam vorbeugen.
Besondere Aufmerksamkeit fand die Erkenntnis, dass eine hohe Diversität, wie sie für den Darm von Naturvölkern beschreiben wird, im Kontext der vaginalen Gesundheit nicht zielführend ist. Am Beispiel des Volkes der Hazda, die immer noch als Jäger und Sammler leben, konnte Dr. Schwiertz aufzeigen, dass eine hohe bakterielle Diversität nur deshalb vorteilhaft ist, weil die vorkommenden Mikroorganismen bei der Verdauung von Ballaststoffen hilfreich sind, die in der westlichen Nahrung nicht mehr vorkommen und deshalb diese Organismen fehlen. Der Schluss, dass eine hohe Diversität immer mit Gesundheit verbunden ist, konnte am Beispiel des vaginalen Mikrobioms widerlegt werden. Hier ist diese ein Zeichen für eine Erkrankung.


Prof. Dr. habil. Marc Birringer widmete seinen Vortrag dem Thema "Der Mikronährstoffbedarf bei Frauen – Aspekte der geschlechtersensiblen Forschung". Seit 2011 ist er Professor für Angewandte Biochemie für Ernährung und Umwelt am Fachbereich Oecotrophologie der Hochschule Fulda. Prof. Dr. habil. Marc Birringer ist Autor und Co-Autor von mehr als 100 Publikationen und Übersichtsartikeln. Aktuell forscht er zu den Eigenschaften und der Analyse von Mikronährstoffen und sekundären Pflanzenstoffen und beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen Bewertung von Lebensmitteltrends. Er ist Mitglied der Gemeinsamen Expertenkommission zur Einstufung von Borderline-Stoffen des BVL und BfArM und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Nationalen Ernährungsmonitoring (NEMO) des Max-Rubner-Instituts. Seit 2020 unterstützt er die Zeitschrift „Applied Research“ (Wiley) als Chief Editor.
Prof. Dr. Birringer beleuchtete in seinem Vortrag die vielfältigen geschlechterspezifischen Unterschiede in der Medizin – mit besonderem Fokus auf den Mikronährstoffbedarf von Frauen. Er machte deutlich, dass viele Krankheiten sich bei Frauen anders manifestieren als bei Männern: Sie treten häufiger oder seltener auf, zeigen andere Symptome und verlaufen oft schwerer. Auch die Wirkung von Medikamenten kann sich deutlich unterscheiden. Dennoch sind Frauen in medizinischer Forschung bis heute strukturell unterrepräsentiert – ein Problem, das unter dem Begriff „Gender Data Gap“ zusammengefasst wird.
Diese Datenlücke ist besonders in der Ernährungs- und Pharmakologie gravierend. Viele klinische Studien schließen Frauen – etwa wegen hormoneller Schwankungen oder Schwangerschaft – aus. In der präklinischen Forschung dominieren männliche Tiere und Zelllinien. Das Ergebnis: Medikamente, Diagnosen und Ernährungsempfehlungen basieren meist auf männlichen Standards, was zu einer suboptimalen Versorgung von Frauen führt.
Besondere Aufmerksamkeit widmet Prof. Paul der Mikronährstoffversorgung, die bei Frauen aufgrund biologischer und lebensphasenbedingter Faktoren (Menstruation, Schwangerschaft, Stillzeit, Menopause) deutlich andere Anforderungen stellt. Kritisch seien vor allem Eisen, Folsäure, Vitamin D, Jod und Selen. So haben etwa rund ein Drittel der Frauen eine Eisenmangelanämie, wobei Symptome wie Müdigkeit oder Konzentrationsschwäche oft lange unerkannt bleiben. Auch Folsäuremangel ist ein ernstzunehmendes Problem – insbesondere vor und während der Schwangerschaft, da ein Mangel das Risiko für Neuralrohrdefekte beim Fötus erhöht. Die empfohlene Supplementierung ist vielen Frauen jedoch nicht bekannt oder wird nicht umgesetzt.
Zudem wies Prof. Birringer darauf hin, dass Selen eine besondere Rolle im Schilddrüsenstoffwechsel spielt und bei Frauen häufig unterhalb der empfohlenen Tageszufuhr liegt. Wegen seiner geringen therapeutischen Breite kann eine unkontrollierte Supplementierung allerdings auch Risiken bergen – etwa ein erhöhtes Risiko für Typ-2-Diabetes. Auch Kalzium wurde angesprochen, vor allem im Hinblick auf die Prävention von Osteoporose, die Frauen im Alter überproportional betrifft.
Abschließend betonte Prof. Birringer, dass der Gender Data Gap nicht nur in der medizinischen Grundlagenforschung und Pharmakologie, sondern auch in der Ernährungswissenschaft existiert – mit weitreichenden gesundheitlichen und ökonomischen Folgen. Eine bessere Aufklärung, speziell zur Mikronährstoffversorgung in verschiedenen Lebensphasen, sei entscheidend, um Frauen eine gesunde und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.hs-fulda.de/oecotrophologie/ueber-uns/professuren/profil/person/prof-dr-marc-birringer-153/contactBox





Der Sonntag startete mit einem Vortrag von M. Sc. Marcel Lackner, Abteilungsleitung biochemische und immunologische Diagnostik am Institut für Mikroökologie. Darin zeigte er neue Wege in der Nahrungsmittelunverträglichkeitsdiagnostik auf. Marcel Lackner studierte Biotechnologie mit Schwerpunkt Biomedical Sciences an der Technischen Hochschule Bingen und der Hochschule Mannheim, wo er 2019 seinen Masterabschluss erwarb. Forschungserfahrung sammelte er unter anderem in Lissabon und am Fraunhofer Center for Molecular Biotechnology (USA). Seine Masterarbeit bei Boehringer Ingelheim befasste sich mit der bildgebenden Massenspektrometrie zur Quantifizierung niedermolekularer Substanzen. Von 2019 bis 2022 promovierte er an der Universität Tübingen und forschte am Institut für Klinische Pharmakologie Stuttgart zur massenspektrometrischen Analyse von Stoffwechselprozessen in Brustkrebs. Seit September 2022 ist er Projektmanager für Biomonitoring am IfM. Im April 2024 übernahm er zusätzlich die Leitung der Abteilungen für biochemische Stuhldiagnostik und immunchemische Blutdiagnostik. Dort entwickelt er mit seinem Team innovative diagnostische Methoden für gastrointestinale Erkrankungen, Mikrobiom-Wirt-Interaktionen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
Marcel Lackner stellte in seinem Vortrag die Weiterentwicklung der KAP-Diagnostikplattform des IfM – einer modular aufgebauten Plattform zur serologischen Analyse IgG-vermittelter Nahrungsmittelunverträglichkeiten (Typ-III-Allergien) – vor. Diese immunologischen Reaktionen bleiben häufig unerkannt, da sie zeitverzögert auftreten und vielfältige Beschwerden wie Magen-Darm-Störungen, Hautreaktionen, Gelenkschmerzen oder Migräne auslösen können.
Die neue Plattformgeneration ermöglicht die quantitative Bestimmung spezifischer IgG-Antikörper gegen bis zu 280 Lebensmittel. Dank automatisierter Laborprozesse und optimierter Auswertungsalgorithmen kann die tägliche Analysekapazität von 60 auf 150 Proben gesteigert werden, bei gleichzeitig höherer Präzision und Reproduzierbarkeit.
Die überarbeitete Befunddarstellung erleichtert die Interpretation deutlich. Auffällige Lebensmittel werden farblich hervorgehoben und mit konkreten Empfehlungen zur individuellen Karenzdauer ergänzt. Hinzu kommen aktualisierte Therapieempfehlungen zur Schleimhautregeneration, Stabilisierung der Darmbarriere und Mikronährstoffversorgung.
Ein weiteres Element der neuen KAP-Diagnostik ist die neue Rezeptbuchplattform für den KAP300. Patient:innen erhalten auf Basis ihres Befunds ein individuell zusammengestelltes Rezeptbuch. Es wird automatisch aus einer umfangreichen, professionell gepflegten Rezeptdatenbank generiert, die sowohl diagnostizierte Unverträglichkeiten als auch persönliche Ernährungsgewohnheiten, etwa vegetarische oder histaminarme Ernährung, berücksichtigt. Die Rezepte sind optisch ansprechend aufbereitet und klar strukturiert.
Zudem sind die Befunde mehrsprachig verfügbar, was die internationale Anwendung erleichtert und die Kommunikation in mehrsprachigen Praxen verbessert. Die KAP-Plattform vereint damit präzise Diagnostik mit praxisnaher Umsetzung im Alltag.
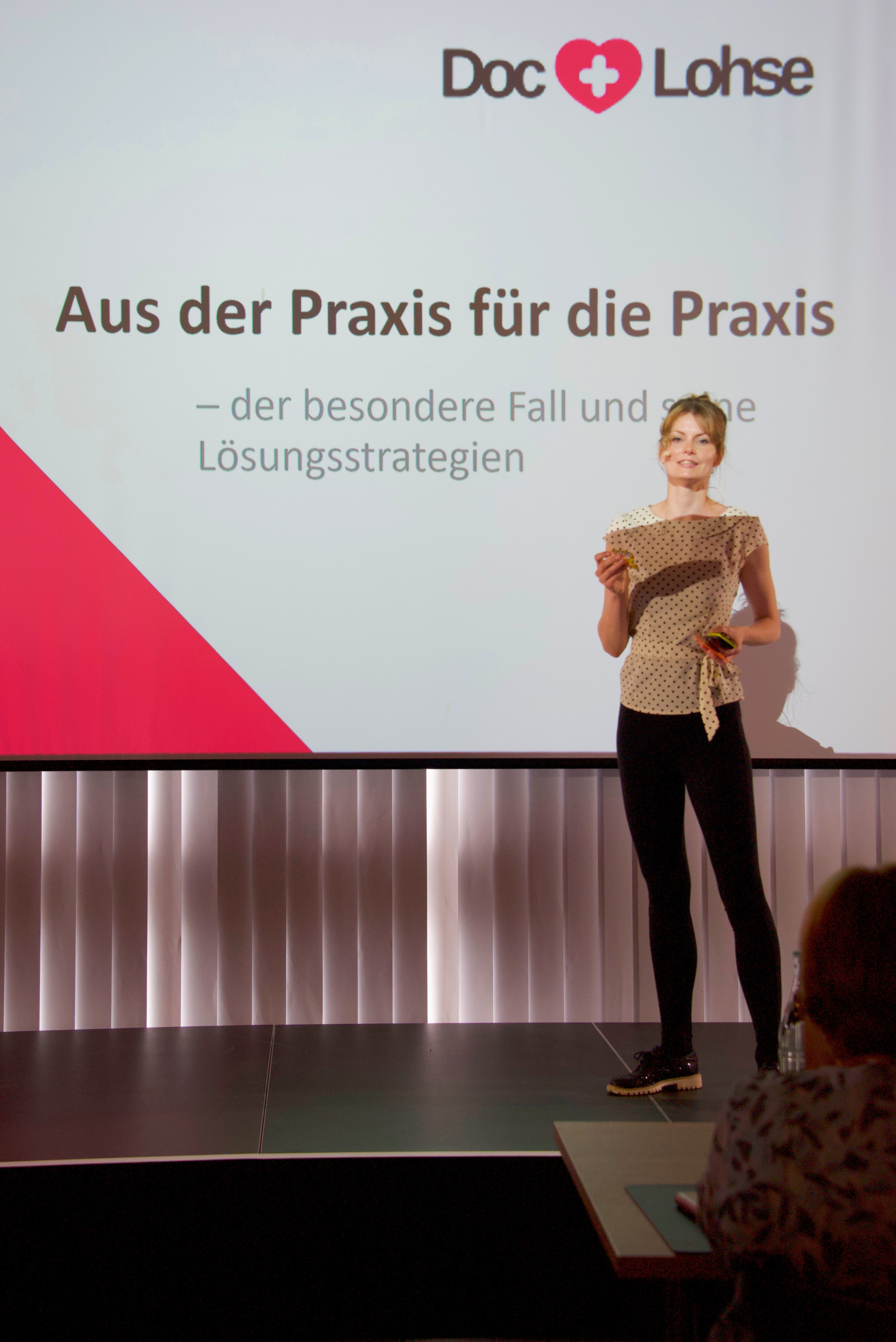

Dr. med. Constanze Lohse, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Präventologin, referierte zu dem Thema "Aus der Praxis für die Praxis – der besondere Fall und seine Lösungsstrategien". Sie ist in ihrer eigenen Praxis in Norderstedt bei Hamburg niedergelassen. Dr. med. Lohse hat sich auf die Bereiche Ernährungsmedizin, Mikronährstofftherapie, Sportmedizin, Naturheilkunde sowie Darmgesundheit spezialisiert und verfolgt in ihrer klinischen Praxis einen ganzheitlichen Therapieansatz, der individuelle Lebensstilfaktoren berücksichtigt. Darüber hinaus ist sie bundesweit als Referentin tätig und vermittelt fundiertes Wissen zu gesundheitlichen Themen. Sie ist Autorin des Buches „Die 10 Minuten- Naturmedizin“ (GU Verlag), einem ganzheitlichen Gesundheitsratgeber, der prägnante Empfehlungen aus den Bereichen Ernährung, Mikronährstoffe, Bewegung, Schlaf, Stressmanagement sowie naturheilkundliche Heilkräfte präsentiert – kombiniert mit den neuesten Erkenntnissen aus dem Gewohnheitstraining. Ihr berufliches Leitmotiv lautet: „Gesunde Ernährung ist meine Leidenschaft und mein wirksames Medikament für meine Patienten.“ Dieses Prinzip spiegelt ihre Überzeugung wider, dass eine evidenzbasierte, ganzheitliche Medizin maßgeblich zur Prävention und Behandlung chronischer Erkrankungen beiträgt.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.doc-lohse.de
In ihrem Vortrag stellte Frau Dr. Constanze Lohse die wachsende Bedeutung funktioneller und ganzheitlicher Medizin bei chronischen Erkrankungen in den Mittelpunkt. Angesichts der Tatsache, dass rund 40 % der Bevölkerung in Deutschland an mindestens einer chronischen Erkrankung leiden, sei ein rein symptomorientierter Behandlungsansatz nicht mehr zeitgemäß. Vielmehr seien chronische Erkrankungen häufig multifaktoriell bedingt – durch Umweltgifte, Fehlernährung, Bewegungsmangel, Stress, Rauchen oder stille Entzündungen – und erforderten ein systemisches, ursachenorientiertes Vorgehen.
Dr. Lohse betonte, dass die Basis einer solchen Herangehensweise eine fundierte Diagnostik sei, u. a. über Mikronährstoffanalysen, Mikrobiomdiagnostik und die Erfassung des vegetativen Nervensystems. Sie stellte das Prinzip „Messen – Wissen – Handeln“ als Leitlinie vor. Die Therapie umfasse dann typischerweise Ernährungstherapie, gezielte Mikronährstoffsupplementierung, mikrobiologische Therapie sowie die Optimierung von Lebensstilfaktoren wie Bewegung, Schlaf und Stressregulation.
Einen besonderen Fokus legte Dr. Lohse auf praktische, alltagstaugliche Empfehlungen, die Patient*innen direkt umsetzen können. Diese Tipps gelten unabhängig von spezifischen Diagnosen und bieten eine wertvolle Grundlage zur Stärkung von Mikrobiom, Immunfunktion und allgemeinem Wohlbefinden:
Allgemeine Alltagstipps zur Unterstützung der Gesundheit und des Mikrobioms:
- Den Tag starten mit: Einem großen Glas Wasser und 1 EL Apfelessig – regt die Verdauung an und unterstützt das Mikrobiom.
- Mikrobiomfreundliches Frühstück: Naturjoghurt oder pflanzlicher Joghurt, Haferflocken, Beerenobst, Leinöl und Walnüsse – liefert Prä- und Probiotika sowie gesunde Fettsäuren.
- Vitamin D und Omega-3 nicht vergessen: Tägliche Einnahme (Vitamin D gewichtsadaptiert dosieren, z. B. 50 IE/kg KG) – wichtig für das Immunsystem und hormonelle Balance.
- Mittagessen mikrobiomfreundlich gestalten: Die Hälfte des Tellers sollte mit Gemüse gefüllt sein – idealerweise bunt und ballaststoffreich.
- Täglich eine Gabel Sauerkraut vor dem Abendessen: Fördert die Verdauung und liefert lebendige Milchsäurebakterien.
- Gesunde Snacks für zwischendurch: Salzgurken, Oliven, Walnüsse, Heidelbeeren – nährstoffdicht, fermentiert oder reich an Antioxidantien.
- Einkaufsverhalten anpassen: Möglichst unverarbeitete, saisonale, regionale und Bio-Lebensmittel wählen – für maximale Nährstoffdichte.
- Auf das Omega-6/3-Verhältnis achten: Hochwertige Öle wie Lein-, Hanf- oder Walnussöl bevorzugen und Sonnenblumenöl & Co. reduzieren.
- Fermentiertes regelmäßig einbauen: Probiotische Lebensmittel wie Sauerkraut, Miso, Kombucha, Wasserkefir, Brottrunk integrieren.
- Ballaststoffe gezielt zuführen (präbiotisch): Chicorée, Zwiebeln, Knoblauch, Spargel, Topinambur – sie nähren die „guten“ Darmbakterien.
Dr. Lohse schloss mit dem Appell, Patient:innen konkrete Werkzeuge an die Hand zu geben und sie nicht mit pauschalen Empfehlungen allein zu lassen. Eine integrative Medizin, die Ernährung, Mikronährstoffe und Lebensstil gleichermaßen berücksichtigt, könne nachhaltige Verbesserungen bei chronischen Erkrankungen erzielen – und sei gleichzeitig ein wirksames Instrument zur Prävention.
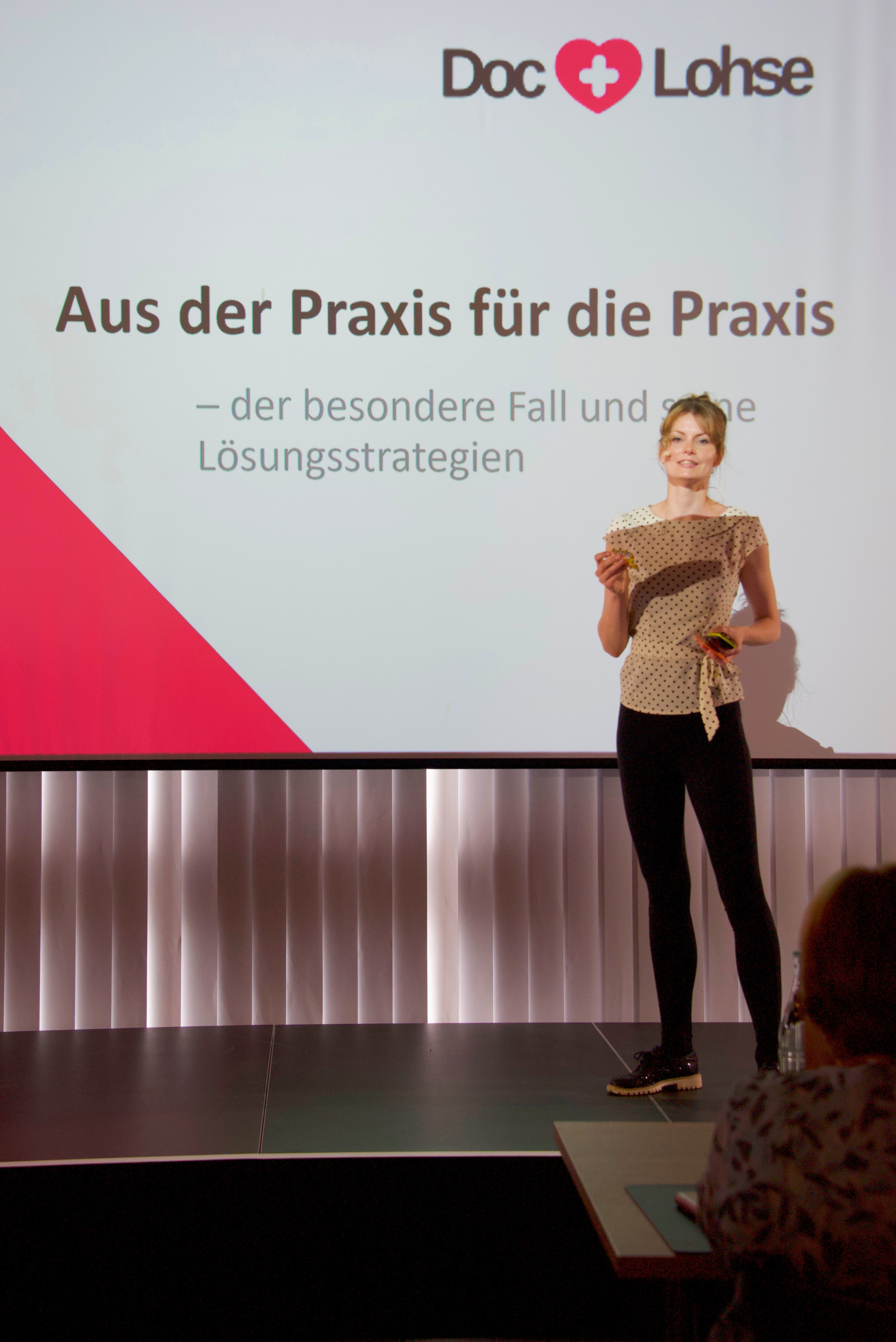




Den Abschluss der Herborner Mikrobiom Tage 2025 machten Dr. med. Thomas Ellwanger, Leiter der medizinischen Wissenschaften am Institut für Mikroökologie. Er zeigte in seinem Vortrag “Abrechnung in der Praxis: Sicher und transparent” anhand von Beispielen die optimale und juristisch belastbare private Abrechnung in Verbindung mit der Diagnostik des Instituts für Mikroökologie auf. Herr Dr. med. Thomas Ellwanger studierte Medizin an der Medizinischen Hochschule in Hannover und ist Arzt am MVZ Institut für Mikroökologie GmbH. Seit 2012 ist er Leiter der medizinischwissenschaftlichen Abteilung des Instituts und ist unter anderem für die Therapieempfehlungen zuständig. Zudem leitet er den medizinischen Hotlineservice und ist auch selbst beratend in der Hotline für Ärzte tätig. Bis Ende 2023 leitete er eine hausärztliche Praxis mit naturheilkundlichem Schwerpunkt und verfügt daher nicht nur über wissenschaftliche, sondern auch langjährige praktische Erfahrung mit der Diagnostik des Instituts sowie deren therapeutischen Konsequenzen. Inzwischen ist er dem Fachpublikum durch mehr als 400 Vorträge bekannt.
Das Team des MVZ Institut für Mikroökologie bedankt sich bei allen Referentinnen und Referenten für die informativen und hochwertigen Vorträge und bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die inspirierenden Gespräche, den regen Austausch und neue Impulse!